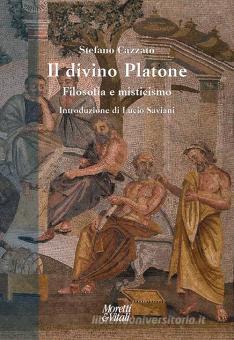Raffaele Arcese
I Manoscritti Economico-Filosofici sono la prima vera espressione della teoria comunista  di Marx e la prima espressione dei suoi studi economici; sono tre quaderni “tirati fuori” ed isolati da un gruppo di nove quaderni che fra il 1843 e il ’45 Marx compone a Parigi, formati da estratti e da annotazioni dei testi classici dell’economia politica. Questi tre quaderni vengono scritti da Marx tra il maggio e l’’agosto del ’44, prima della pubblicazione dell’opera che scrive nel Febbraio ’45 con Engels, “La sacra famiglia”.
di Marx e la prima espressione dei suoi studi economici; sono tre quaderni “tirati fuori” ed isolati da un gruppo di nove quaderni che fra il 1843 e il ’45 Marx compone a Parigi, formati da estratti e da annotazioni dei testi classici dell’economia politica. Questi tre quaderni vengono scritti da Marx tra il maggio e l’’agosto del ’44, prima della pubblicazione dell’opera che scrive nel Febbraio ’45 con Engels, “La sacra famiglia”.
Come gran parte delle opere giovanili di Marx, i Manoscritti vengono abbandonati e lasciati da Marx alla “critica roditrice dei topi”, e vengono pubblicati solo molto tempo dopo la morte di Marx: Le prime edizioni risalgono al periodo tra il 1927 e il ’29, ma solo nel 1932 nella Prima Mega l’allora curatore Adoratskij cura una pubblicazione dei Manoscritti e per la prima volta gli attribuisce un titolo, Manoscritti Economico-Filosofici del 1844; solo nel 1998 si arriva ad un’edizione completa di tutti i nove quaderni parigini di Marx.
Certamente la pubblicazione dei Manoscritti segna e divide la storia del marxismo, segnando due linee precise nella storia delle interpretazioni di Marx:
– Da un lato ci sono le edizioni sovietiche, la cui impronta è data da Riazanov, edizioni che tendono ad una netta svalutazione del significato dei Manoscritti: fin dall’Introduzione di Riazanov ai Manoscritti, essi sono visti come un testo giovanile di Marx, ancora influenzati dall’Idealismo e che vengono pubblicati come semplici appunti e come materiale preparatorio alla Sacra Famiglia. Secondo quest’interpretazione non bisogna pensare che nei Manoscritti sia contenuta la filosofia di Marx e non bisogna perciò dargli troppa importanza.
A quest’interpretazione si richiamerà anche la lettura di Althusser, la cui tesi principale è che c’è una rottura epistemologica nel percorso di Marx (nei Manoscritti c’è un “Marx prima di Marx”) e per il quale i Manoscritti sono l’ultima espressione di una giovanile metafisica di Marx che verrà poi completamente superata da Marx a partire dalle Tesi su Feuerbach e dall’Ideologia Tedesca.
- I Manoscritti diventeranno invece il testo fondamentale di quello che è stato definito “marxismo occidentale” (Fromme, Marcuse, la Scuola di Francoforte ecc.): in questa corrente interpretativa si ritiene che in quest’opera si trovi la teoria dell’alienazione e che essa rimanga la base filosofica permanente in tutta l’opera di Marx, anche se Marx poi non userà mai più quest’espressione. La teoria dell’alienazione dell’uomo è la base filosofica di Marx, da cui deriva ogni altra conseguenza del suo pensiero.
Se c’è continuità o discontinuità nel percorso di Marx, è questa la questione interpretativa in ballo nella storia del Marxismo.
In questi tre quaderni si trovano tre novità fondamentali del pensiero di Marx:
- La prima analisi dell’economia politica, ossia Marx ci dà un’interpretazione delle principali categorie dell’economia politica (capitale, rendita fondiaria, salario).
- La teoria dell’alienazione, ossia quella del lavoro alienato.
- La prima teoria del comunismo, che si lega in maniera strettissima al concetto di alienazione.
Quali problemi pone la lettura dei Manoscritti e in modo particolare la teoria dell’Alienazione? Un 1° problema riguarda il fatto che Marx opera una distinzione fondamentale tra quella che lui chiama la storia dell’industria, l’industrialismo, e la forma sociale determinata del capitalismo: Marx finora ci si è presentato come un autore che attribuisce un valore alla storia dell’industria, che viene vista come la storia delle capacità dell’uomo, fino a considerare la rivoluzione borghese ed il suo pieno compimento come una condizione necessaria per la rivoluzione comunista. Marx perciò non vuole riportare l’uomo nell’idiotismo della vita contadina: il grande problema del comunismo è quello di un governo razionale dello sviluppo industriale.La teoria dell’alienazione sembra invece non solo costituire una critica della forma sociale del capitalismo, ma una critica dell’industrialismo stesso e della tecnica, per cui il comunismo metterebbe in discussione non solo il capitalismo ma lo sviluppo industriale stesso. Nella teoria dell’alienazione Marx non parla dello schiavo, dell’operaio o dell’oppresso, ma parla dell’uomo: si parla dell’uomo in tutto lo sviluppo della storia dell’industria, e Marx usa la categoria di uomo che poi sarà largamente critica da Marx stesso negli scritti successivi.
Il 1° problema che i Manoscritti pongono è quello di capire se Marx è un critico del capitalismo o è un critico dell’intero sviluppo dell’industria.
Il 2° problema riguarda il rapporto tra le categorie critiche fondamentali di Marx, e Marx dispone di tre principali risorse per compiere la critica della civiltà: l’alienazione, l’oppressione (come regola della storia) e lo sfruttamento (come forma specifica del capitale). Queste parole sono le tre grandi risorse critiche di cui Marx dispone, e Marx si deve sempre interrogare su cosa sia il loro rapporto, quale termine fondi l’altro o se i termini siano distinguibili fra loro.
Nel Manifesto si parla di una regola della storia umana e di una sua deformazione iniziale, presente in ogni forma sociale: tutta la storia è segnata dalla regola dell’oppressione perché questa regola dice che fin dall’inizio la specie umana si divide in due generi di uomini, e perciò l’umanità è spezzata fin dal suo inizio.
Il signore antico si limita a consumare ciò che lo schiavo produce e considera il lavoro come una funzione animale: nella filosofia antica (Aristotele parla dello schiavo come di un animale domestico) c’è la ricerca di ciò in cui l’uomo eccede la funzione animale, e il lavoro non eccede la dimensione animale ma fa parte dell’animalità, non consentendo la libertà. Il signore antico fonda così l’idea di libertà sulla possibilità di occuparsi della pura vita teoretica o della vita civile; bisogna però ricordare che il signore antico scopre la libertà e fonda la civiltà umana, uscendo dalla vita animale (Marx è consapevole che la civiltà greca è una grande civiltà, segnata dal carattere dell’oppressione).
Lo sfruttamento è una seconda risorsa critica di cui Marx dispone; non ha lo stesso significato del concetto di oppressione, e può essere definito come una specificazione storica e decisiva dell’oppressione, perché nella società borghese l’oppressione cambia forma: non c’è più il signore e lo schiavo, ma l’oppressore (il borghese) non può definirsi come un puro consumatore, esso non ha come suo fine la vita teoretica o la vita civile e politica, ma esso è un uomo d’azione ed il fine dello sfruttamento è l’accumulazione e l’arricchimento. Il borghese esercita l’oppressione come regola della storia umana, ma la esercita secondo la forma dello sfruttamento, ovvero estraendo plusvalore dal lavoro dell’operaio salariato sulla base delle condizioni moderne della libertà personale (sarà necessaria l’uguaglianza delle condizioni affinché sia possibile lo sfruttamento).
Quello dell’Alienazione è invece il problema che sorge coi Manoscritti: che rapporto c’è tra essa e sfruttamento o tra essa e oppressione? Bisogna abbandonare l’alienazione considerandola una forma giovanile e presto superata da Marx? La teoria dell’alienazione che si trova all’inizio del percorso del Marx economista e comunista cerca di spiegare perché l’uomo è entrato nella vicenda dell’oppressione (mentre il Manifesto ed il Capitale si muovono più sul territorio del “come”, spiegando come si muove la storia e sulla base di quale regola o come funzioni lo sfruttamento).
I Manoscritti vogliono invece rispondere alla domanda sul perché, portandoci indietro al rapporto originario tra uomo e natura e tra uomo e uomo: per Marx c’è una continuità fondamentale, l’uomo è rapporto con la natura (la natura è il corpo inorganico dell’uomo) e ha un rapporto organico con gli altri uomini. Accade però che questa continuità si spezza e che l’uomo appare frammentato, e questa continuità dà luogo ad una disgregazione che a sua volta apre la strada alla storia dell’uomo come storia dell’oppressione.
È l’alienazione che cerca di spiegare l’oppressione e lo sfruttamento (e non è invece il contrario), ma è anche vero che non si può semplicemente concludere che questa è la filosofia di Marx, poiché questa filosofia la si indica nella filosofia della praxis, mentre la teoria dell’alienazione è una spiegazione radicale della regola della storia umana, ossia del fatto dell’oppressione.
La storia umana presuppone anzitutto il segno negativo, ossia la negatività del bisogno e la negatività del lavoro: Marx nell’Ideologia Tedesca comincia con la negatività del bisogno, per cui l’uomo è attraversato da questa mancanza ed è costretto dalla natura a produrre la sua vita: i bisogni negativi sono quelli dettati dalla natura e non ordinati dall’uomo stesso. Nella stessa Ideologia Tedesca Marx scrive che la soddisfazione del 1° bisogno (ossia il bisogno naturale) trasforma la natura stessa del bisogno, il bisogno si moltiplica e da naturale diventa umano: nel comunismo l’uomo pone a sé stesso i suoi fini ed i suoi bisogni non sono più ordinati dalla natura, ma da sé.
Nei Manoscritti il bisogno da negatività si converte in fatto umano: l’uomo non usa più il “grido della natura” per salvarsi dalla morte (come indicava Rousseau), ma cresce le sue possibilità di comunicazione: da un bisogno naturale iniziale nasce un bisogno ed un fine umano. La stessa cosa accade per il lavoro: nella storia dell’oppressione il lavoro è negatività, è un prezzo che viene pagato, tanto che il signore antico fonda una civiltà e l’idea di libertà emancipandosi dalla pena del lavoro, lasciandolo al servo e allo schiavo.
Come nel caso del bisogno, Marx opera la conversione della negatività del lavoro nella positività del lavoro, che nella sua visione diventa realizzazione dell’essenza dell’uomo, cambiando segno rispetto al modo con cui il signore lo aveva considerato: la negazione del lavoro spiega l’origine dell’oppressione ed essa stessa è la radice dell’alienazione. L’alienazione è il motivo per cui l’umanità si spezza e si divide in due generi opposti, poiché il signore ha la necessità di delegare ad altri questa funzione animale.
Marx arriva a questa tesi soprattutto grazie a Hegel e a Locke (col suo 2° Trattato sul Governo e la sua teoria sul diritto di proprietà), e arriva a leggere il lavoro come oggettivazione e come realizzazione dell’essenza umana: l’alienazione si fonda su questa conversione deformata della positività (che Marx chiama oggettivazione) in negatività, ovvero la negazione del valore del lavoro e della praxis, e quindi espropriazione del prodotto del lavoro, ossia espropriazione di quella che Marx chiama essenza generica (Gattungswesen) dell’uomo.
La critica che Arendt rivolge a Marx su questo punto, correggendolo con la distinzione tra ciò che è lavoro e ciò che è opera: per Marx il lavoro è sempre opera, è sempre oggettivazione della prassi, è l’uomo che pone a sé stesso i suoi fini e si oggettiva nel prodotto della sua oggettivazione. In Marx nella società borghese l’uomo è alienato è espropriato del prodotto, ma non perde la capacità di oggettivazione di sé poiché altrimenti non sarebbe il soggetto della rivoluzione, anche il capitalista è alienato ma egli è solo alienato poiché non oggettiva sé stesso.
Il proletario è oggettivazione di sé e al tempo stesso alienazione, e per questo il proletario liberando sé stesso paradossalmente libera l’intera società ed anche il capitalista, poiché il lavoro positivamente considerato è oggettivazione, espressione di sé.
L’alienazione non è invenzione di Marx, ma è un grande e importante concetto della storia della filosofia:
- Ne parla Tommaso Campanella nella Metafisica, parlando di quando l’oggetto perde valore
- Rousseau nel Contratto Sociale, nel 6° capitolo del 1° libro, ne parla nei termini dell’alienazione totale di ciascun associato con tutti i suoi diritti a tutta la comunità: è l’alienazione di ciascun associato alla volontà generale che fonda la volontà generale.
- Nella lingua tedesca ci sono due espressioni che si possono più o meno tradurre con alienazione, Entoisserung ed Entfremdung: Entoisserung ha dentro di sé l’alterità, l’altro, mentre Entfremdung ha dentro di sé l’estraneità, l’estraneo.
L’alienazione ha dentro di sé questi due significati, ed in Hegel compare prevalentemente come Entoisserung: il farsi altro è un’esperienza di arricchimento, un farsi altro che arricchisce la natura del soggetto (ad esempio, il farsi altro dello Spirito nella Natura per diventare più compiutamente Idea).
In Feuerbach invece l’alienazione è prevalentemente Entfremdung poiché ha il carattere della perdita di sé, nella proiezione della sua essenza di vita che l’uomo fa nella figura di Dio: l’uomo si aliena nel senso di una perdita secca, poiché senza l’elemento della coscienza di ciò che succede (ossia la consapevolezza) toglie a sé stesso e proietta nell’immagine di Dio, di cui dimentica la genesi e che crede indipendente da sé.
In Marx è presente l’alienazione in entrambe le accezioni:
- Essa è presente sia come Entoisserung, ed essa intesa come oggettivazione (ciò che Arendt chiama opera): l’uomo essenzialmente realizza la sua essenza alienandosi nel prodotto, cioè oggettivandosi
- Ma è anche presente come Entfremdung, ossia l’alienazione dell’operaio nella fabbrica moderna: Marx, riprendendo quasi letteralmente un’espressione di Feuerbach, scrive che più l’operaio trasferisce nel prodotto, nella società capitalistica, più toglie a sé stessa, e diventa tanto più povero quanto maggiore è la ricchezza che produce.
La teoria dell’alienazione presente nei Manoscritti si presenta come una sorta di crescendo musicale di tre diversi tipi e accezioni di alienazione, in cui dall’aspetto economico (che consiste nell’alienazione del prodotto) si arriva progressivamente all’aspetto più propriamente filosofico (l’alienazione della propria essenza generica di uomo):
- La prima figura la si comprende solo se si tiene presente cosa significhi per Marx lavoro e prassi umana: l’operaio mette sé stesso nel prodotto, si oggettiva e attraverso questa oggettivazione abbandona la dimensione animale (la sua umanità è nell’opera che ha compiuto, nel suo prodotto). Con questo determinarsi nell’opera l’operaio crea un mondo artificiale e abbandona la ripetitività della natura, fondando una storia, che ha una base naturale ma che la oltrepassa continuamente.
L’uomo si oggettiva in una storia e in una civiltà, realizza sé stesso secondo fini razionali (ossia posti da lui stesso, l’uomo diventa sostanzialmente prassi razionale); nella società capitalistica l’uomo, nella figura dell’operaio, continua a oggettivarsi e a conferire valore alla natura, fondando una storia, ma la merce è espropriata al lavoratore: questo può rendersi come l’immagine di una vera e propria rapina, dove però bisogna capire cosa venga derubato.
Viene derubato qualcosa di fondamentale dell’essere umano, e si pone di fronte all’operaio come una potenza indipendente e come qualcosa che gli è estraneo; la sua oggettivazione diventa estraniazione, l’uomo si realizza nell’oggetto ma il suo oggetto gli viene sottratto. Con questa prima figura dell’alienazione avviene quindi la conversione del positivo nel negativo.
- Vi è poi una seconda figura, che è quella decisiva, ma che è anche una conseguenza della prima figura (ossia dell’espropriazione del prodotto); nella società borghese l’operaio non è espropriato solo della cosa, cioè della merce che lui produce, ma dentro il suo prodotto c’è qualcosa di più: quello che viene sottratto all’operaio è l’atto della produzione, la praxis stessa. Espropriare l’atto della produzione significa espropriare l’umanità e la capacità di oggettivazione dell’operaio, la sua creatività.
In questa seconda figura appare un concetto fondamentale dei Manoscritti, quello dell’animale: essere ridotti all’animale significa essere ridotti ad un essere e ad un’esistenza che è separata dal lavoro, un’esistenza che si limita a consumare l’oggetto per la sua sopravvivenza e opera un semplice scambio organico, non elaborando l’oggetto e dunque non entrando nell’artificio.
La differenza tra l’uomo e l’animale è tutta in questa prassi razionale, cioè in questa capacità di oggettivazione dell’uomo: l’uomo lavora non solo per rispondere al bisogno dettato dalla natura, ma per creare un mondo artificiale e dunque per rispondere a bisogni e a fini che lui stesso si pone.
In cosa consiste nell’alienazione del lavoro? Consiste anzitutto nel fatto che il lavoro è esterno all’operaio (vi è dunque la separazione del lavoro dall’operaio), cioè non appartiene al suo essere e dunque nel suo lavoro egli non si afferma ma si nega, sentendosi infelice; perciò l’operaio solo fuori dal lavoro si sente presso di sé, e si sente invece fuori di sé nel lavoro, e perciò il lavoro è solo un momento per soddisfare bisogni estranei.
L’estraneità del lavoro si rivela nel fatto che nel momento in cui viene meno la costrizione, esso viene fuggito come la peste; ne viene quindi come conseguenza che l’operaio si sente libero soltanto nelle sue funzioni animali (mangiare, bere, procreare ecc..) e invece si sente non più che una bestia nelle sue funzioni umane (il lavoro): ciò che è animale diventa umano e ciò che è umano diventa animale. Per questo motivo l’alienazione tocca il valore del lavoro e il valore del bisogno.
- Infine si arriva alla terza figura dell’alienazione, dove non si tratta neanche più dell’atto dell’oggettivazione del produttore, ma dove invece l’alienazione riguarda la Gattungswesen, la sua essenza generica (il suo essere-di-specie): è in questa terza figura dell’alienazione che Marx ci “accompagna fuori dalla fabbrica” e ci fa guardare l’umanità nel suo insieme, l’
L’Uomo (categoria sulla quale poi Marx polemizzerà) per il Marx dei Manoscritti è come un nodo, che stringe insieme due relazioni inestricabili: da un lato il rapporto uomo-natura, la loro continuità essenziale, e dall’altro il rapporto tra uomo e uomo. -L’uomo è ricambio organico con la natura ed è anche essere sociale, e questi due lati sono lo stesso Gattungswesen, la stessa natura del genere umano: l’uomo è in rapporto con la natura solo in quanto essere sociale, ed è in rapporto con l’altro uomo soltanto in quanto produce la propria esistenza (il ricambio organico con la natura).
La relazione con la natura e con gli altri uomini sono due momenti di uno stesso nodo: la natura nel suo insieme è il corpo inorganico dell’uomo (mentre il corpo organico è costituito dalla sua fisionomia), e sia attraverso il suo corpo organico e il corpo inorganico l’uomo è sempre parte della natura, e la governa essendo prassi che trasforma la natura.
Per Marx la vita umana è questa continuità essenziale tra uomo e uomo e tra uomo e natura, ma nella storia, e più precisamente nella modernità borghese, questa continuità si spezza: l’uomo si separa dalla natura e si separa dall’altro uomo, la sua essenza va in pezzi. L’alienazione di questo nesso costitutivo che costituisce l’uomo è perciò la forma più radicale di alienazione, che lo priva della sua capacità di produrre storia (e pertanto lo riduce alle sue funzioni animali).
Il comunismo invece è la situazione che riunifica quello che la modernità borghese ha spezzato, che ricongiunge l’uomo alla natura attraverso la liberazione della praxis: il comunismo supera la frammentazione della società borghese perché restituisce all’uomo la sua capacità di essere artefice di storia. Nei Manoscritti Marx scrive con un linguaggio giovanile, ed anche un po’ poetico, che il comunismo realizza l’uomo totale: l’uomo si riappropria del suo essere onnilaterale.
Qual è il rapporto che nei Manoscritti si determina con la rivoluzione borghese? Marx sa riconoscere il positivo della rivoluzione borghese e delle opere compiute dalla borghesia, però la rivoluzione borghese ha fatto delle promesse, ossia quelle di scardinare il sistema signorile e affermare il principio del merito e della dignità del lavoro, ma per Marx essa non ha mantenuto le sue promesse: ha frammentato l’uomo e ha affermato un nuovo tipo di signoria, perciò il fatto dello sfruttamento ha conservato la regola dell’oppressione.
Ma già nei Manoscritti è presente anche la critica feroce al comunismo primitivo, ossia di coloro che pensano che il problema si risolvi tornando al di qua della rivoluzione borghese, perciò sempre all’interno della regola dell’oppressione: Marx scrive che il comunismo è il risultato della storia umana (perciò parla di risultato, di ciò che viene dopo), l’intero movimento della storia è l’atto di nascita dell’esistenza del comunismo. La storia dell’industria (la tecnica) è il libro aperto delle forze essenziali dell’uomo, scrive Marx, perciò essa dimostra ciò di cui l’uomo è capace, mostra il progresso, ed il compito del comunismo è di portarla oltre la regola dell’oppressione.
L’uomo del comunismo non è solo l’uomo si riappropria del prodotto del lavoro, dell’atto della produzione e del rapporto con la natura e con l’altro uomo, ma si presenta con un’alterazione fondamentale rispetto all’uomo come lo si è conosciuto in tutta la storia, cambiano i sensi umani: il comunismo restaura il sentire, l’odorare, l’amare e tutto ciò che appartiene alla vita più elementare dell’uomo. I sensi vengono convertiti da sensi individuali a sensi sociali.
Il presupposto di questo discorso che Marx fa sul sentire è che il sentire nel pensiero di Marx è mediazione: il rapporto con l’oggetto non è mai nella radice un avere o un consumare, ma un produrre. Il rapporto tra sensi individuali e sensi sociali corrisponde a quello che nell’economia di Marx è il rapporto tra il consumo e la produzione: l’uomo della civiltà borghese è un uomo che consuma e che si situa nella logica dell’avere, mentre l’uomo del comunismo è prassi razionale, e produce l’oggetto che consuma.
L’uomo con tutti i sensi si afferma nel mondo oggettivo, l’oggetto diventa oggetto sociale e nel comunismo l’uomo esce dalla logica del semplice avere e del semplice consumare l’oggetto: anche il senso (la vista, l’udito ecc.) nel comunismo diventa praxis, diventa mediazione e produzione dell’oggetto, uscendo dalla dimensione del puro consumismo.